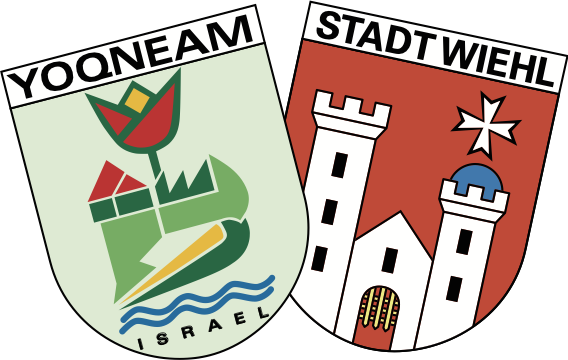Gegen das Vergessen und zur Mahnung!
Gedenkstunde auf dem ehemaligen jüdischen Friedhof in Nümbrecht am 09.11.2024

Rede von Michael Striss vom 09.11.2024
Sehr geehrte Damen und Herren,
danke, dass Sie hierhergekommen sind. Wir kommen hier zusammen in Nümbrecht. Einer Stadt, in der früher auch die Familien Herz, Baer und Goldbach wohnten. Und eine Stadt, die eine Synagoge hatte. Dass das heute nicht mehr so ist, das liegt an unseren Vorfahren. Am 2. Oktober1942 wurde seitens der Stadt dem damaligen Landrat ganz offiziell schriftlich mitgeteilt: Es gibt keine Juden mehr in Nümbrecht.
So stehen wir nun hier an diesem Ort. Und ich überlege: Was würde uns vielleicht die frühere Einwohnerin Meta Herz heute sagen wollen, wenn sie es denn könnte? Oder Leo Baer? Vielleicht: „Ihr habt jeweils eine kleine Straße nach uns benannt. Eine Geste, okay. Ihr selbst seid auch nicht verantwortlich für das, was eure Vorfahren taten oder zuließen. Aber für die Gegenwart, für die seid ihr verantwortlich. Und die sieht wieder bedrohlich aus für uns Juden in Deutschland. Es brennt, Brüder und Schwestern, es brennt!“ Ich erinnere daran, dass erst kürzlich auch Manfred Lütz bei einer Festveranstaltung auf Schloß Homburg seinen Vortrag zum Thema „Glück“ damit begann: „Ich schäme mich dafür, dass Juden heute in Deutschland ihre Kippa verstecken müssen, wenn sie auf die Straße gehen.“ Das hätte zum Stimmungskiller werden können angesichts eines eigentlich humorvoll gedachten Abends. Aber die Zeiten erfordern offenbar auch solche Stellungnahmen. „Es brennt, Brüder und Schwestern, es brennt!“ Vielleicht bei uns noch nicht in hohen Flammen, aber aufgeheizt ist es schon. Und die aktuellen Bilder aus Amsterdam wecken bedrückende Assoziationen an den November 1938.
Um das zu erkennen, um den Antisemitismus in seinen vielfältigen Formen zu erkennen, möchte ich mit Ihnen über zumindest eine Wurzel des Judenhasses, über ein Grundmotiv nachdenken. So wie es in der Kürze möglich ist. Mir scheint das wichtig zu sein, als Mensch und auch als Christ.
Man kann das Krebsgeschwür des Antisemitismus politisch, gesellschaftlich oder geschichtlich betrachten. Es wird aber nicht reichen, es allein rational zu erklären.
Nie in der Menschheitsgeschichte waren die Juden etwas anderes als eine Minderheit unter den Völkern, nie eine Großmacht. Nie haben Juden ein Weltreich erobert wie die Perser, Griechen und Römer, wie die Mongolen oder die Briten. Auch im Vergleich zu heutigen Großmächten in der Welt muss niemand fürchten, von Juden überrannt und erobert zu werden. Trotzdem gibt es kein Volk, das über Jahrtausende so angefeindet, so gehasst wurde. Durch alle Epochen hindurch haben Antisemiten immer wieder die Auslöschung der Juden angestrebt.
Da war z.B. der Antijudaismus der christlichen Kirche. Angeblich waren die Juden schuld an der Kreuzigung Jesu. Dabei lehrt uns die Bibel klar, dass wir alle, jeder einzelne Mensch seinen Anteil daran hat – durch unsere Abkehr von Gott. Diese Form des Antisemitismus angeblich im Namen des Evangeliums aber hat große Schuld mit sich gebracht. Christen haben vergessen, dass ihr Herr Jude war. Und dass unsere Bibel uns auffordert: „Tröstet, tröstet mein Volk!“ (Jesaja).
Doch Judenfeindlichkeit gab es schon vor dem Christentum. Sie reicht bis in die Antike und hat sich während der römischen Kaiserzeit zugespitzt. Ab dem 7. Jahrhundert breitete sich zudem der islamische Antisemitismus aus. Er benötigte das Christentum nicht, um seine Judenfeindschaft zu begründen, sondern hat seine eigene ganz klare religiöse Motivation und Agenda.
In der Neuzeit wurden antisemitische Theorien über eine angeblich verborgene Weltherrschaft der Juden in Europa salonfähig. Angesehene Denker wie Voltaire und Hegel beteiligten sich und bereiteten den späteren Nazis den Boden.
Die Judenfeindlichkeit kam allerdings stets auch von links, wie die Geschichte der europäischen Arbeiterbewegung des 19. und 20. Jahrhunderts und der marxistischen Klassiker zeigt. Auch in Russland gab es große Pogrome. Und vor seinem Tod hatte Stalin noch geplant, alle Juden in das autonome Gebiet Birobidshan zu deportieren und unterwegs ein Drittel von ihnen zu erschlagen.
Auch Jahrzehnte nach dem Holocaust ist der Antisemitismus in Europa keine Randerscheinung. Im Gegenteil nimmt er wieder stark zu. Hat einen neuen Höhepunkt erreicht seit 7.10. Dieses Datum wird im Gedächtnis bleiben wie der 9. November 1938. Interessant, wenn man fragt: Was verbindet rechtsextreme Kreise, Islamisten und Linksextreme miteinander? Judenhass kennt keine politischen Grenzen, sondern führt zu ungeahnter Verbrüderung. Und was man früher nur an dumpfen Stammtischen vermutete, findet sich heute an den Unis, wo unsere künftige Elite ausgebildet wird. Jüdische Studenten trauen sich nicht mehr in den Hörsaal. Große Teile des westlichen Bildungswesen und der Kulturszene sind davon betroffen. Häufig unter dem Etikett des Antikolonialismus und der Israelkritik wird dabei der Islamismus hofiert. „Es brennt, Brüder und Schwestern, es brennt!“
Fazit: Antisemitismus überwindet alle zeitlichen, politischen oder religiösen Grenzen. Eben dies ist etwas, das schnell übersehen wird. Aktuell etwa bei Diskussionen über Israel und Gaza. Da dominiert die Sicht, der Konflikt lasse sich nur durch eine Neueinteilung der Territorien lösen. Diese Sicht aber bleibt an der Oberfläche. Erfasst sie wirklich die Wurzel des Problems? Unabhängig von Israel wütet der islamistische Judenhass nämlich seit Jahrhunderten und würde auch dann weiterbestehen, wenn es gar keinen jüdischen Staat gäbe. Es ist ein Hass mit dem erklärten Ziel, alle Juden weltweit auszulöschen. Und er schwappt nach Deutschland, wo wir erleben müssen, dass auf unseren Straßen das genozidale Massaker der Hamas gefeiert wird. Wo es zur Täter-Opfer-Umkehr kommt und es an Empathie für die Opfer fehlt.
Allein rational ist das nicht zu erklären. Wir kommen deshalb nun zu den religiösen Aspekten. Das ist mir wichtig: Antisemitismus betrifft das Verhältnis des Menschen zu Gott.
Der Gott der Bibel hat die Juden zum auserwählten Volk erklärt und ihnen die Zehn Gebote u.a.m. anvertraut, das auch zu den Grundlagen des Christentums und der westlichen Zivilisation gehört. Im Jahr 2010, zum 65. Gedenktag der Befreiung von Auschwitz, hatte Papst Benedikt XVI. ausgeführt: „Im Tiefsten wollte man mit dem Zerstören Israels, mit dem Austilgen dieses Volkes den Gott töten, der Abraham berufen, der am Sinai gesprochen und dort die bleibend gültigen Maße des Menschseins aufgerichtet hat (. . .). Wenn dieses Volk einfach durch sein Dasein Zeugnis von dem Gott ist, der zum Menschen gesprochen hat und ihn in Verantwortung nimmt, so sollte dieser Gott endlich tot sein und die Herrschaft nur noch dem Menschen gehören.“
Dass der Mensch den Wunsch hat, kein Geschöpf, sondern autonom und selber Schöpfer zu sein, zeigt bereits am Anfang der Bibel die Geschichte von Adam und Eva. Das Judentum lässt sich als permanentes Zeugnis gegen diesen Wunsch verstehen. Als Zeichen und Mahnung dafür, dass Gott die Regeln des Lebens setzt, und dass die Juden unter den Völkern, wie die Bibel sagt, besonders gerufen sind, die Welt an diese Regeln zu erinnern. Jesus sagte: „Das Heil kommt von den Juden.“
Das erregt heftigen Anstoß. Bei den anderen Religionen ebenso wie bei Atheisten oder auch technologiegläubigen Menschen, die von der Machbarkeit aller Dinge überzeugt sind. Ein Ärgernis für alle, die sich dagegen verwahren, das Leben als etwas zu sehen, das sich einem Gott verdankt, den man lieben und dessen Gebote man halten sollte. Ein Ärgernis für alle, die selber im Chefsessel der Existenz sitzen wollen.
Indem man das Judentum auslöscht, will man auch dieses Ärgernis auslöschen. Man möchte vergessen, dass kein Mensch über seine Geburt, seinen Tod, über sein biologisches Geschlecht oder über den letzten Sinn des Lebens verfügen kann. Und man möchte vergessen, dass das Judentum (zusammen mit dem Christentum) die Grundlagen für unsere Zivilisation, für Freiheit und Menschenwürde gelegt hat.
Wenn aber die westliche Demokratie, wie wir sie heute kennen, bei allen ihren Schwächen die beste aller möglichen Grundlagen für ein Leben in Freiheit und Würde darstellt, für Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit, dann ist der Antisemitismus eine Gefahr für uns alle. Dann stehen sich am Ende nicht Freunde und Feinde des Judentums gegenüber, sondern Freunde und Feinde der Freiheit. Und Freunde und Feinde einer Weisheit, die uns daran erinnert, dass Gott keine Erfindung des Menschen ist, sondern der Mensch eine Erfindung Gottes.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Lassen Sie uns aufmerksam bleiben, um zu erkennen, wo sich Judenhass in unterschiedlicher Gestalt und auch Verkleidung unter uns zeigt. Damit es nicht nochmal heißt: „Und ihr steht und schaut umher mit verschränkten Armen, Und ihr steht und schaut umher, unser Städtchen brennt!“ Shalom!


Bilder: Martin Szepat
Zum 86. Jahrestag der Reichspogromnacht am 9. November 1938 veranstalteten die Gemeinde Nümbrecht, die Freundeskreise Wiehl/Jokneam und Nümbrecht-Mateh Yehuda sowie die Oberbergische Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit eine Gedenkfeier, zu der sie alle Bürgerinnen und Bürger aus Nümbrecht, Wiehl und Umgebung an den ehemaligen jüdischen Friedhof in Nümbrecht einluden.
„Gegen das Vergessen und zur Mahnung!“
Das Erinnern an die schrecklichen Ereignisse des 9. November 1938, als Einrichtungen und Besitztümer jüdischer Menschen in Deutschland systematisch zerstört und geschändet wurden, sei im Jahr 2024 wichtiger denn je, hieß es in der Einladung.
Nach der Begrüßung der zahlreich erschienenen Anwesenden durch Bürgermeister Hilko Redenius und einem Wortbeitrag von Landrat Jochen Hagt hielt Pfarrer Michael Striss aus Wiehl, Synodalbeauftragter des Ev. Kirchenkreises an der Agger für das Christlich-Jüdische Gespräch, die Hauptansprache, durch die sich die Feststellung „Es brennt, Brüder und Schwestern, es brennt“ wie ein Leitmotiv zog.:
Striss begann seine Rede, ausgehend vom Hier – Nümbrecht – und Jetzt – 9.11.2024 –, mit dem Hinweis, dass die Juden im Dritten Reich aus Nümbrecht vertrieben worden seien, sodass die Gemeinde 1942 offiziell als „judenfrei“ deklariert wurde. Zwar seien die Menschen heute nicht für die Taten und das Verhalten der Vorfahren verantwortlich, wohl aber für die Gegenwart, die für die Juden in Deutschland wieder bedrohlich aussehe. Die aktuellen Bilder weckten jedenfalls bedrückende Assoziationen an 1938. Auch Jahrzehnte nach dem Holocaust sei der Antisemitismus in Europa keine Randerscheinung, sondern nehme seit dem 7.10. wieder stark zu.
Er wolle mit den Anwesenden „über zumindest eine Wurzel des Judenhasses, über ein Grundmotiv…nachdenken, um den Antisemitismus in seinen vielfältigen Formen zu erkennen.“ Dies sei ihm wichtig, als Mensch und auch als Christ. Antisemitismus könne man unter verschiedenen Aspekten betrachten, politisch, gesellschaftlich, geschichtlich oder, wie an letzter Stelle ausgeführt, unter religiösem Aspekt: Auch wenn viele das vergessen wollten, habe das Judentum zusammen mit dem Christentum die Grundlagen für unsere Zivilisation, für Freiheit und Menschenwürde gelegt.
Striss beendete seine exzellente, eindringliche Rede mit dem Appell, „aufmerksam zu bleiben, um zu erkennen, wo sich Judenhass in unterschiedlicher Gestalt (…), unter uns zeigt“ und ihm aktiv entgegenzutreten.
Einen schönen, wichtigen und zur Rede von Pfarrer Michael Striss passenden Beitrag zur Gestaltung der Gedenkstunde leisteten die Schülerinnen der TOB – Sekundarschule der Stadt Wiehl mit ihrem engagierten, leidenschaftlichen Vortrag des jiddischen Liedes „S’brent, brider, s‘brent!“, womit sie eine Analogie zu den aktuellen antisemitischen Ausschreitungen nicht nur auf deutschen Straßen und an deutschen Universitäten herstellten. Der Liedtext von Mordechai Gebirtig gipfelt in der Aufforderung an die angegriffenen, bedrohten Juden, sich zu wehren, nicht tatenlos zuzusehen und sich nicht ihrem Schicksal zu ergeben.
Der Geiger Jaroslaw Petresky verlieh der Gedenkfeier einen bewegenden musikalischen Akzent und Rahmen mit den Musikstücken „Supplication“ (Flehentliche Bitte) von Ernest Bloch und der Titelmelodie aus dem Film „Schindlers Liste“.
Siehe auch:
Nümbrecht aktuell | 46. Jahrgang | Nr. 24 | Freitag, 22. November 2024 | Kw 47 | Rautenberg Media